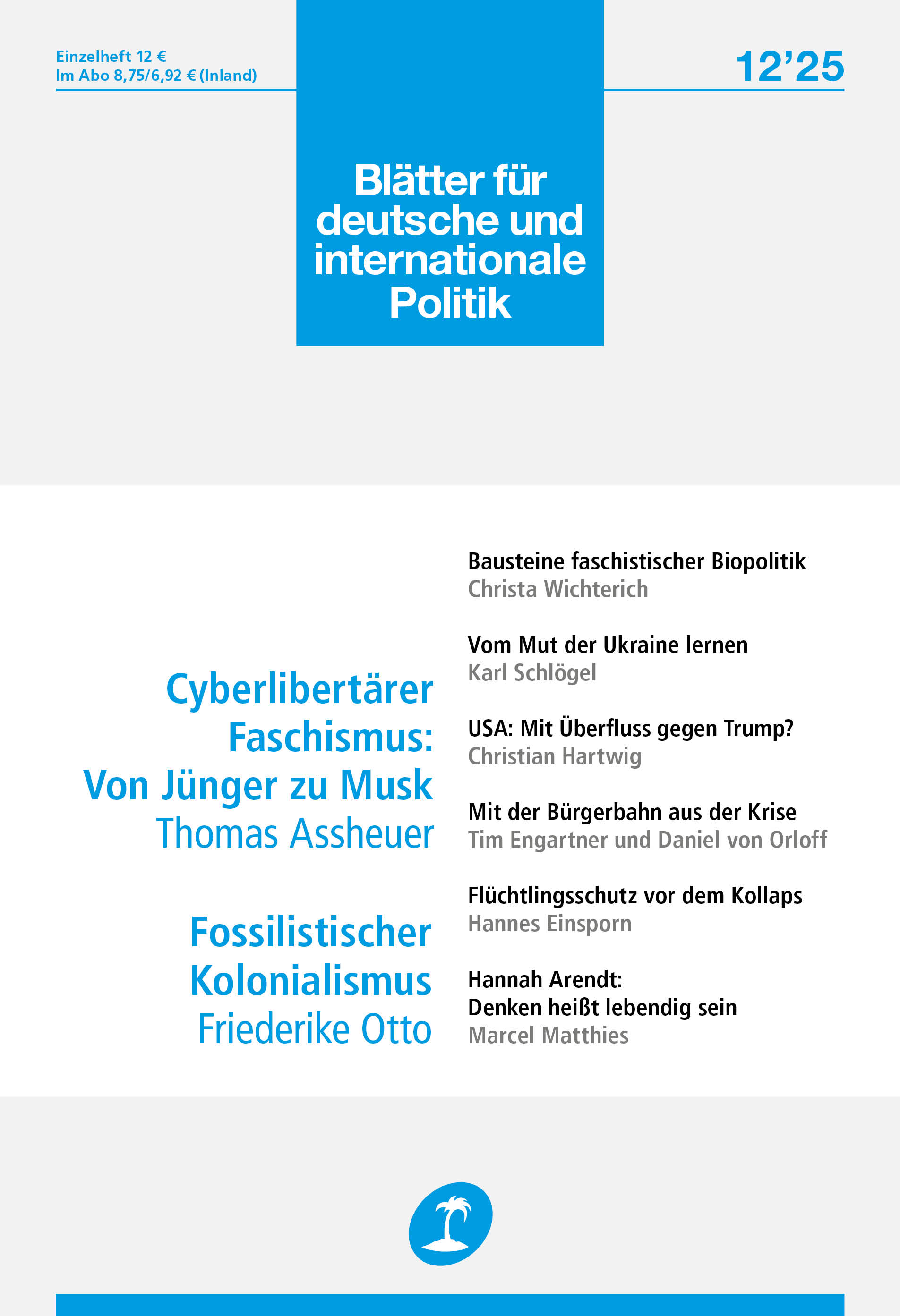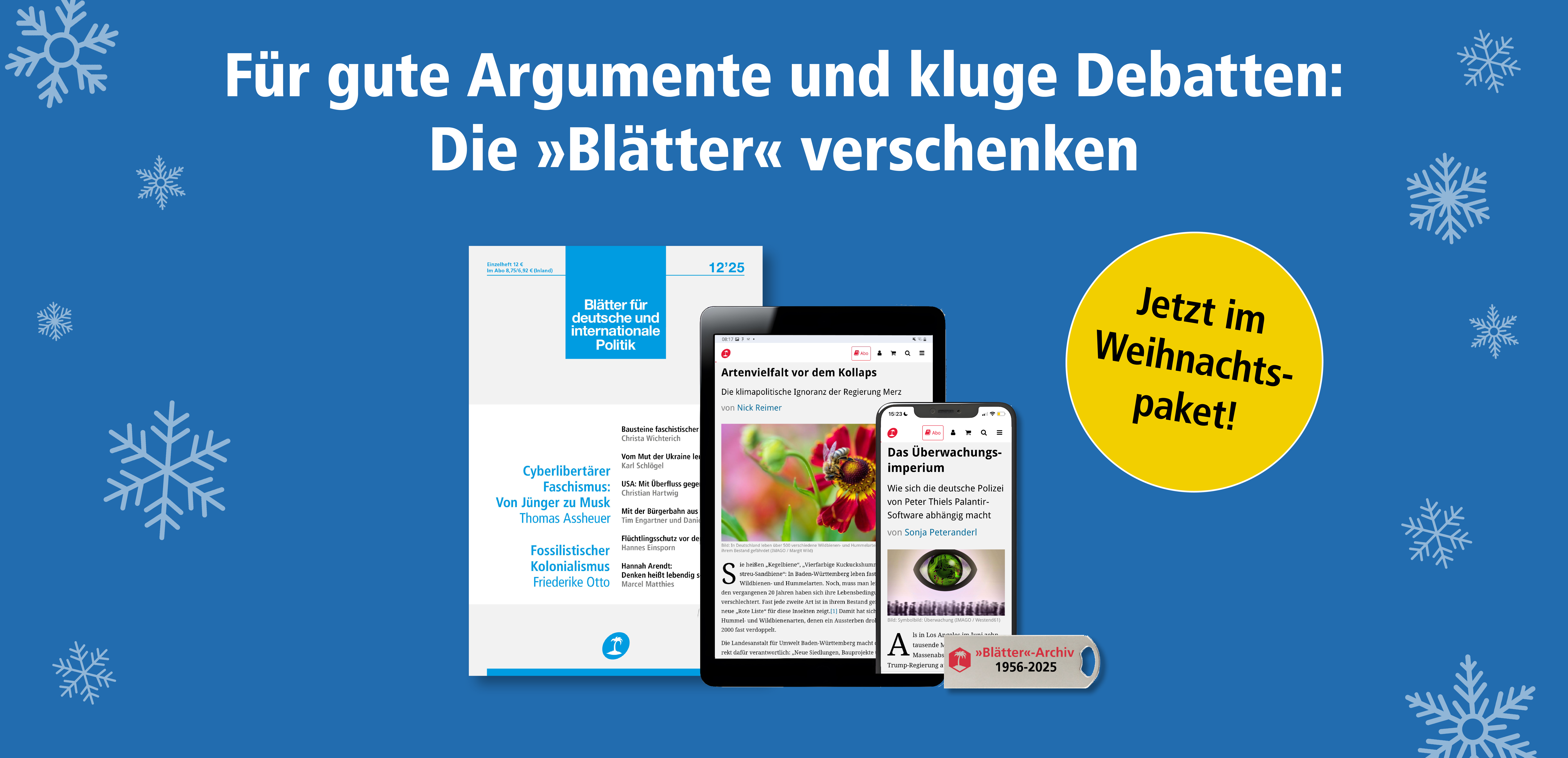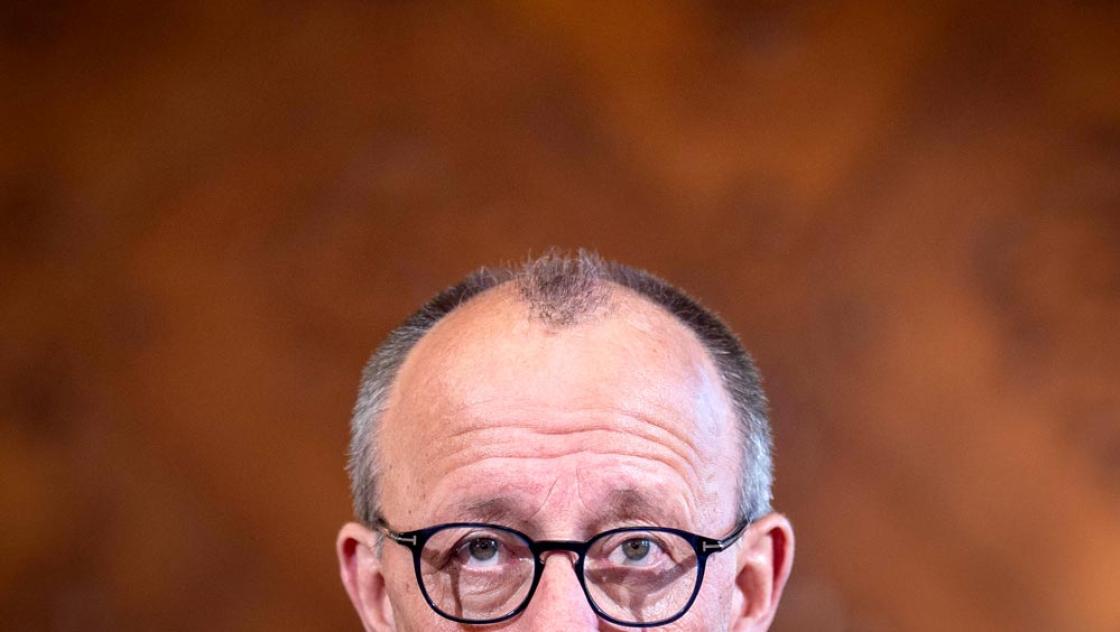
Bild: Bundeskanzler Friedrich Merz beim Pressestatement im Hamburger Rathaus, 25.11.2025 (IMAGO / Chris Emil Janßen)
2025 war ein bitteres Jahr für die Demokratie. In den USA arbeitet Donald Trump an ihrer Abschaffung, aber auch in den ältesten europäischen Demokratien, Frankreich und Großbritannien, stehen die altgedienten Parteien massiv unter Druck. Gleichzeitig wirkt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan darauf hin, seinen gefährlichsten Kontrahenten Ekrem Ìmamoğlu für 2352 Jahre, so die Forderung der Generalstaatsanwaltschaft, und damit auf Nimmerwiedersehen hinter Gitter zu bringen. Der Autoritarismus ist also auch in diesem Jahr auf dem Vormarsch. Immerhin gab es mit den Wahlsiegen der proeuropäischen Parteien und Kandidaten in Moldau und Rumänien auch einige Hoffnungsschimmer. Und der Sieg von Rob Jetten in den Niederlanden erbrachte den Beweis dafür, wie man gegen Rechtspopulisten vom Schlage Geert Wilders punkten kann, nämlich mit Themen, die dezidiert nicht die Migration bespielen.
Dagegen gibt die Lage in Deutschland zu großer Besorgnis Anlass, zumal gerade Berlin angesichts des Rechtsrucks in den anderen großen Staaten Europas von entscheidender Bedeutung ist. Aber auch bei uns hat sich das Parteiensystem durch das Erstarken der AfD fundamental verändert. Wie mit Silvio Berlusconis Aufstieg in Italien und dann mit dem Emmanuel Macrons in Frankreich erleben wir auch in Deutschland das Ende der demokratischen Nachkriegszeit, nämlich das Ende der alten Bipolarität von zwei sich an der Macht abwechselnden Parteien der Mitte: Christdemokraten und Sozialdemokraten.
Die SPD hat mit der Wahlschlappe von Olaf Scholz ihren Status als Volkspartei, jedenfalls auf Bundesebene, eingebüßt. Der eigentliche Zweikampf um die Macht spielt sich heute zwischen CDU/CSU und AfD ab. Doch fataler noch: Nach nur gut einem halben Jahr der schwarz-roten Koalition sind deren Zustimmungswerte schlechter als die der Ampel nach drei Jahren. Zudem hat die AfD die Union in den Umfragen ein-, ja sogar teilweise überholt, was in der Union die Panik umgehen lässt. Längst werden dort Überlegungen angestellt, ob man die Koalition verlassen und eine Minderheitsregierung eingehen sollte. „Wir werden nicht mit der SPD untergehen“, so drohend Fraktionschef Jens Spahn.
Damit steht die Frage im Raum, ob das, was im Fall der Ampel noch als Ausnahme erschien, zum Normalfall der Bundesrepublik zu werden droht, nämlich die Unfähigkeit einer Koalition, ihre Legislaturperiode überhaupt zu Ende zu bringen. Ist Deutschland also auf dem Weg zu italienischen Verhältnissen?
All das spielt sich in einer außenpolitischen Lage ab, die die Dramatik des ersten Ampel-Jahres 2022 noch übertrifft. Der große Krieg gegen die Ukraine und die offene Feindschaft Russlands gegenüber der EU stellt zwar noch immer die größte Belastung dar. Zudem aber hat sich die Lage an zwei weiteren geopolitischen und -ökonomischen „Fronten“ massiv verschlechtert. Mit dem neu-alten US-Präsidenten kommt der Angriff gegen den demokratischen Westen jetzt auch aus dessen Zentrum selbst, quasi vom Westen des Westens her. Speziell das deutsche Exportmodell wird von Trumps Zollkrieg gegen die EU im Kern getroffen. Hinzu kommt, dass China als bisher wichtiger Abnehmer deutscher Exportwaren seinerseits brutal zurückschlägt, und zwar in gleich doppelter Hinsicht. Mit seinen hoch subventionierten Produkten, die nun statt in die USA noch stärker als zuvor nach Europa gehen, attackiert China besonders Deutschland, allen voran den deutschen Automarkt im Bereich der E-Mobilität. Und zugleich übt China mit der Exportlimitierung von Seltenen Erden und Mikrochips massiven Druck auf die EU und speziell Deutschland aus.
Rasende Abwärtsspirale
Das ist die hochproblematische Ausgangslage im Jahr eins der großen Koalition, die ihren Namen schon lange nicht mehr verdient. Umso mehr müsste Schwarz-Rot eine Win-win-Situation generieren, damit beide Parteifamilien aus ihren schwachen Wahlergebnissen herauswachsen können. Doch das Gegenteil ist der Fall, die Koalition „funktioniert“ derzeit nur im Modus des Nullsummenspiels: Was der eine gewinnt, verliert der andere. Da aber beide gewinnen wollen, spielen sie permanent gegeneinander – mit dem Ergebnis, dass es auf den zentralen Feldern, von Rente bis Wehrpflicht, allenfalls zu dürftigen, hart erkämpften Formelkompromissen kommt, die niemanden wirklich überzeugen. So verlieren am Ende beide, Union und SPD. Und nur einer gewinnt: die AfD als der lachende Dritte.
Die vermeintlich große Koalition – diese angeblich „letzte Patrone der Demokratie“ (Markus Söder) – hat damit das geschafft, was es unbedingt zu vermeiden galt, nämlich den Eindruck zu erwecken, dass auch sie nicht in der Lage ist, geschlossen und entschlossen zu regieren. Von der versprochenen Aufbruchstimmung in Wirtschaft und Gesellschaft kann daher keine Rede sein. Würde heute gewählt, wäre Schwarz-Rot von einer Mehrheit weit entfernt. Und ein Ende der Abwärtsspirale ist nicht in Sicht.
Wenn Friedrich Merz eine „blockierte Republik“ beklagt, hat er also einerseits recht, aber andererseits hat er selbst entscheidend zu dieser Blockade beigetragen. Faktisch zieht sich durch die ersten Monate seiner Kanzlerschaft eine Spur des strategischen Scheiterns, die allerdings bereits zuvor begann – nämlich mit dem Sündenfall der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD im deutschen Bundestag. Hierher rührt das anhaltende Misstrauen in den Reihen der SPD, speziell unter Parteilinken.
Doch wer gemeint haben sollte, Merz werde aus den verschiedenen Rückschlägen seine Lehren ziehen, sieht sich am Ende des Jahres getäuscht. Was bei vielen Spitzenpolitikern zu beobachten ist, findet sich bei ihm offensichtlich in besonderem Maße, nämlich Beratungsresistenz. Bei Merz manifestiert sich eine trotzige Unwilligkeit, aus Schaden klug zu werden, allerdings fatalerweise nicht nur zu seinem eigenen Schaden oder dem der Union, sondern der gesamten Regierung und damit eines zunehmend orientierungslosen Landes.
Immer wieder kommt in dieser Koalition, quasi als Reiz-Reaktions-Schema, das gleiche Stück zur Aufführung: Merz provoziert („Fragen Sie ihre Töchter!“), die Opposition außer- und innerhalb der Regierung protestiert – und die AfD profitiert von der Zerstrittenheit der demokratischen Parteien. Von der harten Abschottungspolitik gegenüber Polen über die missglückte Wahl von Frau Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin bis hin zur unsäglichen „Stadtbild“-Debatte zieht sich eine durchgängige Linie, nämlich der Wille der Union, die „Auseinandersetzung“ mit der AfD ausgerechnet und fast ausschließlich auf dem einzigen Feld zu suchen, auf dem den Rechtsradikalen Kompetenzwerte zugeschrieben werden, nämlich dem der Migrationsbekämpfung. „Die drei wichtigsten Themen: Migration, Migration, Migration“, hatte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bereits im Wahlkampf postuliert. Die Konsequenz waren 28 Prozent und damit das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der Union. Und das Elend setzt sich bis heute unverändert fort: Das monothematische Agieren bei gleichzeitiger Ausgabe nicht einhaltbarer Versprechen (Innenminister Dobrindt plane großangelegte Abschiebungen, so Merz bei seiner ersten Stadtbild-Äußerung) lässt die Zustimmung zur AfD weiter wachsen, genau wie den Riss in der Koalition.
Die Union befindet sich längst in einer Überbietungsfalle: Das, was sie fordert, kann sie faktisch gar nicht umsetzen. Die AfD aber fordert die Umsetzung weiter und spielt so Hase und Igel mit Merz und Co. Angesichts der sinkenden Werte der Koalition, und speziell der Union, wird es zunehmend einsam um den Kanzler. Er hat sich derartig festgefahren, dass er nicht mehr vorwärts und auch nicht mehr rückwärts kann. Symptomatisch dafür ist die Lage in der Rentenfrage: Auf der einen Seite verweigert ihm die Junge Gruppe in der Union die Gefolgschaft, auf der anderen Seite schließt die SPD jede Veränderung am Rentenpaket kategorisch aus. Würde das Rentenpaket tatsächlich an der knappen Koalitionsmehrheit von nur zwölf Stimmen im Bundestag scheitern, stünde der Kanzler nach nicht einmal einem Jahr vor den Trümmern seiner Amtszeit. Und man fühlte sich, nolens volens, an das Scheitern der Weimarer Republik erinnert.
Vor bald einem Jahrhundert, im Sommer 1930, kam es zum Bruch der letzten großen Koalition der ersten deutschen Demokratie. Den Ausschlag gab damals, angesichts der dramatischen Probleme im Zuge der Weltwirtschaftskrise, eine Petitesse, nämlich der Streit über eine kleine Beitragserhöhung für die Arbeitslosenversicherung (um 0,5 Prozent). Dem zugrunde lagen, ähnlich wie heute, massive Differenzen zwischen den Koalitionspartnern, die zu immer größeren Fliehkräften in der Koalition und letztlich zu deren Ende führten. Danach begannen die Präsidialkabinette unter Heinrich Brüning: Ohne eigene Mehrheit im Reichstag mussten sie sich stattdessen auf das Notverordnungsrecht nach Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung stützen. Und auch wenn es heute kein Notverordnungsrecht mehr gibt, eines scheint sich gegenwärtig zu wiederholen: die Sehnsucht nach dem Ausstieg aus einer ungeliebten großen Koalition.
Wunschtraum Minderheitsregierung
Daher ist es kein Zufall, dass gerade jetzt in der Union die Debatte um eine Minderheitsregierung anhebt, wie auch um eine Annäherung an die AfD. Immer lauter wird das Ende der Brandmauer gefordert.
Dabei muss man zwischen zwei Fraktionen unterscheiden: jenen, die primär strategisch argumentieren, um die AfD zu schwächen, wie der ehemalige Generalsekretär unter Angela Merkel, der eher liberale Peter Tauber, und den anderen, die auch inhaltlich für eine Annäherung an die AfD plädieren, wie der Mainzer Geschichtsprofessor Andreas Rödder, Kopf von Republik 21, der konservativen „Denkfabrik für neue bürgerliche Politik“, der schon lange für eine „konditionierte Gesprächsbereitschaft“ mit der AfD plädiert, um mögliche Schnittmengen auszuloten. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der konservative Flügel um Rödder und die ehemalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder leidet schon lange unter der babylonischen Gefangenschaft in der Koalition mit der SPD bzw. dem Umstand, dass faktisch keine Koalition in der Mitte außer mit den Sozialdemokraten mehr möglich ist, obwohl es längst eine weit konservativere Mehrheit im Lande gibt, die man rein rechnerisch realisieren könnte – wenn da nicht das Unvereinbarkeitsverbot mit der AfD wäre.
Eine Annäherung, gar eine Zusammenarbeit mit der AfD, etwa auf Landesebene, hätte jedoch dramatische Folgen: Die SPD müsste die Koalition im Bund platzen lassen, schon um nicht selbst von den absehbaren Protesten dagegen weggefegt zu werden.
Damit aber greift die zweite Überlegung, nämlich die einer Minderheitsregierung. Das Aus von Schwarz-Rot hätte keineswegs zwangsläufig Neuwahlen zur Folge, zumal soeben der Haushalt für 2026 verabschiedet wurde. Vielmehr müsste sich die Union wechselnde Mehrheiten organisieren. In Dänemark, Norwegen und Schweden funktionieren derartige Minderheitsregierungen durchaus gut, sind teilweise sogar die Regel. Allerdings aufgrund einer entscheidenden Abweichung: Wegen des sogenannten negativen Parlamentarismus benötigen die dortigen Minderheitsregierungen keine eigene Mehrheit für ein Gesetz; es reicht aus, wenn die absolute Mehrheit nicht dagegen stimmt. Das ist ein Unterschied ums Ganze, macht es doch Minderheitsregierungen erheblich handlungsfähiger und damit stabiler.
In Deutschland sähe die Lage völlig anders aus. Käme es tatsächlich zum Bruch von Schwarz-Rot hätte Merz allergrößte Schwierigkeiten, zu Mehrheiten mit Hilfe der SPD zu kommen. Diese würde umgehend ins Lager der Opposition aus Grünen und Linkspartei wechseln. Und Merz wäre auf eine AfD angewiesen, die sich auf diese Weise salon- und mitregierungsfähig machen könnte. Für die Union wäre dies nichts anderes als Selbstmord aus Angst vor dem Tode.
Immerhin scheint Merz jetzt erkannt zu haben, dass seine bisherige Strategie einer Bekämpfung der AfD durch weitgehende Übernahme ihrer Positionen bei der Migrationsabwehr nicht aufgeht, sondern die AfD-Werte immer weiter wachsen lässt. Man werde sich „mit der AfD auch inhaltlich sehr viel stärker auseinandersetzen“ müssen, so Merz. Es gehe darum, die Unterschiede herauszustellen und den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, was dem Land drohe, wenn die AfD immer stärker werde.
Gut gebrüllt, Kanzler, möchte man Merz zustimmen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn er seine eigenen Worte endlich ernst nähme und die AfD als „Hauptgegner“ nicht nur titulierte, sondern auch behandelte. Dafür käme es für die Union darauf an, nicht länger wie das Kaninchen vor der Schlange namens AfD zu sitzen, sondern endlich deutlich zu machen, wie fundamental die Unterschiede sind – auf dem Feld der Wirtschafts-, Sozial- und vor allem der Außenpolitik. Wie könnte die Adenauer-Union mit einer anti-westlichen Partei koalieren, deren Parteichef Tino Chrupalla den russischen Diktator verharmlost („Mir hat er nichts getan“) und zugleich unsere polnischen Nachbarn dämonisiert („Natürlich kann auch Polen für uns eine Gefahr sein“) und deren Parteiführerin Alice Weidel engste Bande zum Antidemokraten Elon Musk unterhält?
Nein, die Abgrenzung von der AfD sollte für überzeugte Christdemokraten eigentlich kein Problem sein. Der Kanzler hat aber noch ein anderes Problem. Er selbst hat derart hohe Erwartungen geweckt, dass er jetzt kleinlaut eingestehen muss, dass sie – ob bei der Rente oder der Wehrpflicht – in einer Koalition gar nicht oder allenfalls nur zum Teil umsetzbar sind. Damit hat er die Koalition mit der SPD selbst diskreditiert und die Fliehkräfte in Richtung AfD regelrecht gezüchtet. Das ist Merz‘ Dilemma: Während er sich jetzt – endlich – für eine klare Abgrenzung von der AfD ausspricht, werden andere daher unvermindert über den Ausstieg aus der Koalition nachdenken und so die Autorität des Kanzlers weiter untergraben – mit offenem Ausgang.